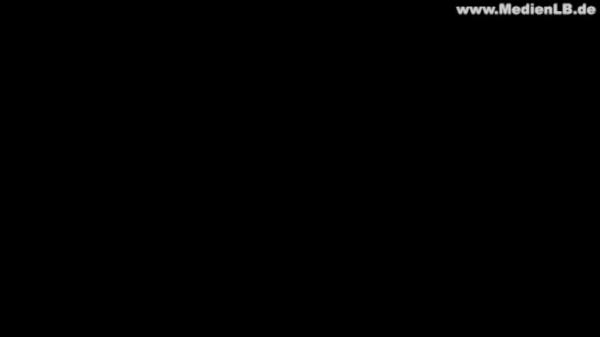Alpengletscher
Mensch und Eis

Alpengletscher (Gesamter Film)

1. Schneegrenze und Eisbildung Die Entwicklung des Klimas und der Einfluss des Menschen darauf wird in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Gletscher und ihr Umfeld sind Zeugen für klimatische Entwicklungen in Vergangenheit und Gegenwart. Die Alpen sind das höchste innereuropäische Gebirge, dass den Kontinent wie ein Riegel teilt. Das Gebirge trägt zahlreiche Gletscher. Österreich ist stark von den Alpen geprägt, die in den Hohen Tauern innerhalb des Landes die größte Höhe erreichen. Dort liegt die Pasterze. Über acht Kilometer lang, achtzehn Quadratkilometer Fläche und 1,8 Kubikkilometer Volumen- das ist die Pasterze, der größte Gletscher der Ostalpen am Großglockner, dem mit 3798 Metern höchsten Berg Österreichs. Wie können sich so gewaltige Eismassen bilden Der Ursprung des Gletschereises ist der Schnee, der auf die höher gelegenen Bereiche der Berge fällt und dort liegen bleibt. Die Grenze, oberhalb derer der Schnee ganzjährig liegen bleibt, wird als klimatische Schneegrenze bezeichnet Diese Schneegrenze liegt in den zentralen Alpen höher als an den nördlichen und südlichen Rändern des Gebirges. Wenn man einen Querschnitt durch die Alpen betrachtet, zeigt sich anhand der vorhandenen Gletscher, dass die Schneegrenze an der Nordseite bei etwa 2500-2800m Höhe und an der Südseite bei etwa 2700-2800m Höhe liegt. Das ist durch die Niederschläge an den Rändern der Alpen bedingt, neben der Temperatur ist also auch der Niederschlag für die Höhenlage der Schneegrenze maßgebend In den Zentralalpen, wo auch die Pasterze liegt, verläuft die Schneegrenze bei etwa 2900 – 3200m Höhe Unterhalb dieser Eisregion schließen sich die Felsregion, die Matten und Almenregion mit vereinzelten Krummhölzern und dann die Nadelwaldstufe an. Diese Zone geht dann in das Hügelland über, wo natürlicherweise der Laubwald das Landschaftsbild beherrscht. Wie kommt es nun zur Bildung des Gletschereises. Der gefallene Schnee drückt durch sein Gewicht die darunter liegenden Schichten zusammen und durch Schmelzwasser, das in die unten liegenden Schichten einsickert und dort gefriert kommt es zur Bildung von Gletschereis. Dabei werden Verunreinigungen und Luft eingeschlossen, wodurch es zur typischen Bänderung des Eises kommt. 2. Funktionsweise eines Gletschers Das untere Ende der Pasterze, die so genannte Gletscherzunge, liegt auf einer Höhe von etwa 2100m, also nahezu einen Kilometer unterhalb der bereits erwähnten Schneegrenze. Wie kann das Eis dorthin gelangen, wenn in diesem relativ niedrigen Bereich kein Schnee ganzjährig liegen bleibt? Das kann nur deshalb geschehen, weil das Eis sich bergab bewegt. Wenn sich oberhalb der Schneegrenze immer größere Eismassen bilden, geraten diese, abhängig von ihrer Masse und der Neigung des Untergrundes, irgendwann in Bewegung und fließen, dem Untergrund folgend, den Berghang hinunter Der Bereich oberhalb der Schneegrenze wird als Nährgebiet des Gletschers bezeichnet, weil dort mehr Eis entsteht als abschmilzt. Bewegt sich das Eis nun in Gebiete unterhalb der Schneegrenze, ins so genante Zehrgebiet, beherrschen zunehmend Abschmelzvorgänge das Geschehen. Die Schneedecke ist im Sommer nicht mehr vorhanden und das blanke Gletschereis kommt zum Vorschein. Je tiefer das Eis sich den Hang hinab bewegt, desto stärker werden die Eismasseverluste, bis schließlich das Eis an der Gletscherzunge vollständig abgeschmolzen ist. Ein Gletscher kann anwachsen oder abschmelzen, dabei bewegt er sich jedoch immer hang abwärts. Wenn er abschmilzt, bewegt er sich langsamer, als wenn er wächst und an Masse zunimmt. Einen anwachsenden Gletscher erkennt man an seiner steilen Stirn Die flache Zunge der Pasterze zeigt, dass es sich um einen abschmelzenden Gletscher handelt, dessen Eismassen sich mit durchschnittlich 30 – 40m jährlich vorwärts bewegen. Dabei bildet sich das Gletschertor immer wieder neu aus. Auffallend sind die Eistrümmer, die von dem zerfallenden Gletscher abbrechen und als Toteisblöcke zurückbleiben. Auch auf der Oberfläche des Gletschers gibt es Schmelzwasserbäche. An einigen Stellen den so genannten Gletschermühlen fließt das Wasser in den Gletscher hinein und bildet Strudel, die am Felsuntergrund so genannte Gletschertöpfe aushöhlen. Bekannt und gefährlich sind die Gletscherspalten, die vor allem dort entstehen, wo das Eis durch steile Abhänge und Stufen im Felsuntergrund aufreißt. Von den umgebenden Hängen stürzt ständig Geröll auf die Oberfläche des Gletschers, das von diesem mitgenommen wird. Dieses Geröll bezeichnet man als Obermoränenmaterial Fließen zwei Seitenarme des Gletschers zusammen, vereinigen sich die seitlich mitgeführten Schuttstreifen - die Seitenmöränen - zu einer Mittelmoräne, die beiderseits von Eis umgeben ist. Ein Fels oder Berg, der komplett vom Eis umgeben ist wie hier der kleine Burgstall, wird nach einem Begriff aus der Inuitsprache als Nunatak bezeichnet 3. Gletscherschwund und Gletschervorfeld Die Alpengletscher hatten in jüngerer Zeit ihre größte Ausdehnung im Jahr 1852, die Pasterze dehnte sich damals bis unterhalb des Margaritzenstausee im Margaritzenbecken aus. Die weiteste Ausdehnung eines Gletschers wird durch Geröllwälle, so genannte Endmoränen, angezeigt. Seitdem hat die Pasterze knapp zwei Kilometer an Länge verloren und ist von diesem Standort aus nicht mehr zu sehen Allein die Veränderungen des Gletschers seit 1960 sind deutlich zu sehen. Die Gletscher des Großglockners sind erheblich kleiner geworden. Besonders auffällig ist der Bereich des Hufeisenbruchs, der den oberen Teil des Gletschers am Johannisberg von der Gletscherzunge im Tal trennt. Während der Hufeisenbruch im Jahr 1960 noch vollständig von Eis bedeckt war, sind heute zahlreiche felsige Bereiche zu sehen. Der Nachschub des Eises könnte bald abreißen und der kleine Burgstall wäre dann auch nicht mehr vom Eis umgeben, das heute schon größtenteils schuttbedeckt ist. Die Höhenabnahme des Gletschers zeigt sich besonders deutlich an der Talstation der Gletscherbahn, die 1963 knapp oberhalb der Gletscheroberfläche errichtet wurde, die nun etwa 100m niedriger liegt. Im Mittelalter war die Pasterze, deren Name soviel wie „Wiese“, bzw. „Weide“ bedeutet, wie praktisch alle Alpengletscher, erheblich kleiner als heute. In der Neuzeit kam es dann zu einem Anwachsen der Gletscher bis zum Jahr 1852. Seitdem nahm die Größe der Gletscher, unterbrochen von kürzeren Vorstoßphasen, bis zum heutigen Niveau ab. Das Eis, dass heute am Gletscherende taut, ist etwa im Spätmittelalter entstanden. Die Gletscher sind das deutlichste, sichtbare Zeichen der Klimaerwärmung, hierbei wird die Rolle des Menschen und der von ihm ausgestoßenen Treibhausgase, wie Kohlenstoffdioxid, sehr kontrovers diskutiert. Während der Eiszeiten bedeckten Gletscher große Teile des bayerischen Alpenvorlandes, dort findet man heute Seen Moore, Dörfer und Städte Wenn der Gletscher abschmilzt, gibt er größere Flächen frei, die vom Gletscherbach, hier der Möll, durch die Kraft des Wassers gestaltet werden. Eisblöcke, die hier liegen bleiben, werden als Toteis bezeichnet, genauso wie Teile der Zunge, die sich nicht mehr bewegen. Dieses Gletschervorfeld, das alsbald von Pflanzen besiedelt wird ist eine echte Urlandschaft Das Wasser der Möll ist trüb, dies bezeichnet man als Gletschermilch, die Trübung rührt von feinsten Sedimentpartikeln her, die der Gletscher und die an ihn angefrorenen Steine vom Untergrund abgeschliffen haben. Diese Erosionsarbeit des Gletschers zeigt sich später in typischen Schrammen auf den glatt geschliffenen Felsen. Nach dem Abschmelzen der Pasterze wurde ab 1958 ein Becken frei, dass sich schnell mit Wasser und den Sedimenten der Möll füllte. Dieses Becken, das heute selten mit Wasser gefüllt ist, wird als Sandersee bezeichnet. Das Wort Sander kommt aus der isländischen Sprache und bezeichnet Flächen, die mit Sedimenten von Gletscherflüssen bedeckt sind. Das Sediment ist deutlich feiner als Sand. Die typische Abfolge von Grundmoräne, Endmoräne und Sander wird als Glaziale Serie bezeichnet. 4. Nutzung der Gletscher Gletscher haben nicht nur für den Naturhaushalt, sondern auch für die Wirtschaft der Alpenländer eine sehr große Bedeutung. Der Margaritzenstausee, der überwiegend von der Möll gespeist wird, wurde nach der Errichtung von zwei Staumauern im Jahr 1952 in Betrieb genommen. Er dient der Erzeugung von Elektrizität, wird jedoch ebenfalls, wie der Sandersee, immer weiter mit den Sedimenten, welche die Möll vom Gletscher heranführt, aufgefüllt. Dies gefährdet seit 1990 zunehmend die Funktion dieses Speichersees. Obwohl Wasserkraft eine saubere Energiequelle ist, zeigen sich hier doch deutlich die Eingriffe des Menschen in die Natur. Gletscher sind Wasserspeicher und wirken so regulierend auf den Naturhaushalt ein. Niederschläge, die sonst in nicht nutzbarer Form in relativ kurzer Zeit über die Bäche und Flüsse abgeführt würden, werden so über einen längeren Zeitraum abgegeben. Eine ganz besonders große Rolle spielen die Gletscher für den Sommertourismus, insbesondere hier im Nationalpark Hohe Tauern. Sie sind ein Anziehungspunkt für viel Menschen. Allein die Großglockner Hochalpenstraße wurde seit ihrer Eröffnung im Jahr 1935 von etwa 50 Millionen Menschen befahren. Der Gletscher selbst wird von zahlreichen Touristen aus aller Welt besucht. Gerade für Menschen aus wärmeren Ländern bietet sich hier die Chance, bei angenehmen Außentemperaturen Schnee und Eis zu sehen, was in ihren Heimatländern nicht möglich ist. Eine besonders starke Anziehungskraft üben die Farben des Eises und seine Reflexionen aus. Da das Interesse der Menschen an Vorgängen in ihrer Umwelt seit den siebziger Jahren des 20.Jh kontinuierlich zunimmt, sind auch die Veränderungen des Gletschers selbst und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Umwelt in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Gerade aus diesem Grunde wurde der Gletscherweg vom Österreichischen Alpenverein im Jahr 1982 geplant und im Jahr 1983 feierlich eröffnet. Vielen Menschen ist unbekannt, dass es auch in Bayern Gletscher gibt. Es handelt sich hierbei um insgesamt fünf kleinere Gletscher, von denen drei an der Zugspitze liegen, nämlich der nördliche und der südliche Schneeferner auf dem Zugspitzplatt und der Höllentalferner im Höllentalkar. Der Watzmanngletscher und das Blaueis am Hochkalter liegen im Berchtesgadener Land. Die Zugspitze, mit einer Höhe von 2962 Metern der höchste Berg Deutschlands, ist ebenfalls das Ziel vieler tausend Touristen aus dem In- und Ausland, die den Gipfel bequem über eine Zahnradbahn und zwei Bergbahnen erreichen können. Von den drei Zugspitzgletschern haben die beiden Schneeferner auch wirtschaftliche Bedeutung, da sie die Skisaison bis in das späte Frühjahr hinein verlängern. Manchmal wird das Gebiet noch als einziges deutsches Sommerskigebiet bezeichnet, was aber seit Jahrzehnten nicht mehr zutrifft, da die Gletscher im Sommer nicht mehr befahrbar sind. Wegen der Eisbewegung müssen die Pfeiler der Liftanlage nach einigen Jahren umgesetzt werden Insgesamt ist die Bedeutung der Alpengletscher für den Skitourismus aber immer noch sehr groß. 5 Die Gletscher der Zugspitze Auch die bayerischen Gletscher sind von der Gletscherschmelze stark betroffen. Die Veränderungen der bayerischen Gletscher werden von Dr. Hagg an der Ludwig-Maximilians Universität in München seit Jahren erforscht. „Statement Dr.Hagg: O- Ton, Dr. Hagg mit Daten etc.)“ Trotz seiner im Vergleich zu der Pasterze sehr geringen Größe zeigt der nördliche Schneeferner sehr deutlich, dass auch kleine Gletscher eine kommerzielle Bedeutung haben können. Um die zukünftige Bewirtschaftung zu sichern, wird der Gletscher im Bereich der Bergstation des Skilifts mit Schutzplanen abgedeckt. So soll verhindert werden, dass durch ein weiteres Abtauen des Eises in diesem Bereich der Anstieg für die Liftbenutzer unüberwindbar wird. Zudem wird mit Pistenraupen Schnee auf den Gletscher befördert, was man „snow farming“ nennt. Der südliche Schneeferner, der auch Skilifte trägt, zeigt nur an wenigen Stellen Spalten, die auf eine Bewegung des Eises schließen lassen. Ob er noch als Gletscher bezeichnet werden kann, ist umstritten. Der östliche Schneeferner kann nicht mehr als Gletscher bezeichnet werden, er ist bis auf wenige unbedeutende Firn- und Eisreste abgeschmolzen. In wenigen Jahrzehnten wird auch der nördliche Schneeferner so aussehen. Der dritte Gletscher an der Zugspitze ist der Höllentalferner, dessen Zunge man vom Zugspitzgipfel aus sehen kann. Der Gletscher ist durch hoch aufragende Felswände gegen die aus Süden scheinende Sonne gut abgeschirmt. Die Zunge des Gletschers hat viele, deutlich erkennbare Spalten, die zeigen, dass noch eine relativ starke Eisbewegung stattfindet. Durch die Abschirmung gegen die Sonne sind die Abschmelzverluste des Gletschers relativ gering. Der Höllentalferner ist etwa einen Kilometer lang und 700m breit. 6. Die bayerischen Gletscher als Klimazeiger Betrachtet man den Gletscher von der anderen, also der nördlichen Seite, wird klar, dass es noch einen weiteren Grund für den relativ guten Zustand des Gletschers gibt Durch die steilen Felswände, die den Gletscher umgeben, erhält er im Winter und im Sommer größere Mengen an Schnee durch Lawinen, einen solchen Gletscher bezeichnet man als Lawinenkesselgletscher. Animierte, digitale Geländemodelle zeigen die Veränderungen von Gletschern besonders eindrucksvoll. Dabei wird mit einem Computer ein dreidimensionales Modell der Landschaft erzeugt auf dem dann die Gletscherdaten verschiedener Jahre wiedergegeben werden können. Das digitale Geländemodell des Höllentalferners zeigt die Veränderungen des Gletschers in den Jahren 1950 bis 1999. Um das Jahr 1980 herum ist eine Vergrößerung der Fläche zu beobachten. Dies zeigt, dass zu dieser Zeit eine kleinere Vorstoßphase stattfand. Seitdem ist der Gletscher wieder etwas kleiner geworden. Das Blaueis am Hochkalter im Berchtesgadener Land ist der nördlichste und am niedrigsten gelegene Gletscher der Alpen. Dieser Gletscher zeigt einen wesentlich deutlicheren Rückgang als der Höllentalferner an der Zugspitze. Die folgenden Bilder zeigen, wie sich das Eis in 110 Jahren verändert hat: In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es hier ebenfalls eine kurze Vorstoßphase, wie sie auch bei anderen Alpengletschern beobachtet wurde. In den 50er Jahren tauchte aufgrund der Eisverluste ein Felsriegel auf. Um das Jahr 1980 kam es auch hier zu einer kurzen Vorstoßphase. Seit den späten 80er Jahren schrumpft der Gletscher kontinuierlich. Der letzte, noch nicht erwähnte Gletscher Bayerns ist der Watzmanngletscher. Bei diesem Gletscher liegt der hier dokumentierte Zeitraum bei 98 Jahren. Der Watzmanngletscher war im Jahr 1959 bereits fast verschwunden. Ein kurzer Vorstoß ist im Jahr 1970 zu beobachten. Dieser Vorstoß intensivierte sich auch hier um das Jahr 1980 Später kam es dann auch am Watzmann, wie bei allen anderen Gletschern zu deutlichen Schmelzvorgängen. Diese Bilder zeigen, dass gerade kleine Gletscher sehr sensible Indikatoren sind, die auch auf geringe Veränderungen schnell reagieren. Die Bayerischen Gletscher sind deshalb für die Klimaforschung sehr bedeutend. Große Alpengletscher, wie die Pasterze, zeigen solche sensiblen Reaktionen kaum, sondern schmelzen seit 1852 meistens kontinuierlich ab Die Schneeferner jedoch, sind aufgrund ihrer Bewirtschaftung für den Skitourismus, nicht mehr für Klimamessungen geeignet, da das „snow farming“ sie, zumindest teilweise, vom Klima abkoppelt. Um sinnvolle Aussagen zur Entwicklung des Klimas machen zu können, werden natürlich auch meteorologische Daten benötigt. Die im Jahr 1900 eröffnete Klimahochstation des Deutschen Wetterdienstes - die Höchstgelegene Einrichtung ihrer Art in Deutschland - liefert solche Daten seit über 100 Jahren. Tatsache ist, dass die Alpengletscher weiter schmelzen werden. Auch wenn nicht alle Alpengletscher verschwinden, wird sich den Reisenden ein anderer Anblick bieten und vor allem die Lebensbedingungen in den Alpen werden sich verändern.