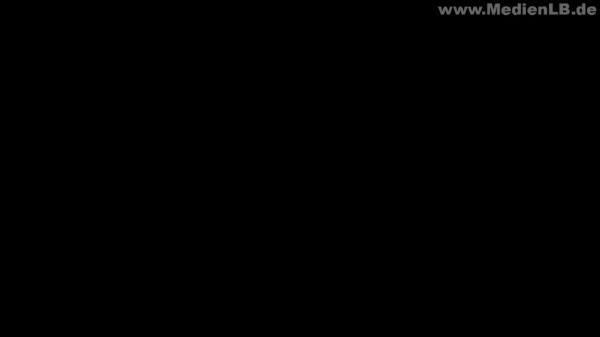Kapitalismus
Eine kritische Analyse

Kapitalismus – Eine kritische Analyse

Intro Der Kapitalismus ist eine weltumspannende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der die Produktionsmittel, wie z. B. Gebäude, Nutzflächen oder technische Anlagen, in privater Hand liegen und die Steuerung des Wirtschaftsgeschehens über den Markt gekennzeichnet ist. Die unvergleichbare Produktivität der kapitalistischen Marktwirtschaft erwächst aus dem Drang zu immer größerem Gewinn sowie der Furcht vor dem wirtschaftlichen Untergang. Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist global und hat sich in den meisten Industrieländern durchgesetzt. Prof. Dr. Hans-Werner Sinn: „Kapitalismus heißt, dass ein Unternehmen geführt wird von einem Eigentümer, der sein eigenes Vermögen riskiert. Das ist der Kern eines kapitalistischen Systems.“ Dirk Müller: „Die Vorzüge eines kapitalistischen Systems sind eben das „Haben wollen“, dass man Eigentum hat, dass man Dinge weiterentwickeln kann, auch über Generationen weitergeben kann.“ Dr. Gregor Gysi: „Der Vorzug des Kapitalismus ist eine funktionierende Wirtschaft und ein funktionierendes Angebot an Waren und Dienstleistungen.“ Hans-Christian Ströbele: „Aber man übersieht dabei, dass dieser Reichtum, über den wir hier in Deutschland verfügen können oder auch in den USA, dass der sehr stark auf Kosten der armen Länder geht.“ 1. Grundlagen unseres Wirtschaftssystems 1.1 Das Kapital Dem Faktor Kapital kommt beim Kapitalismus noch vor allen anderen Wirtschaftsfaktoren eine zentrale Bedeutung zu – ebenso wie das Streben nach Gewinn. Kapital sind Geld und Produktionsmittel, also alle bei der Produktion eingesetzten Mittel wie Gebäude, Maschinen, Anlagen, Werkzeuge oder Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Diese Produktionsmittel befinden sich im kapitalistischen Wirtschaftssystem in privater Hand. Das können Privatpersonen, Aktiengesellschaften und große Konzerne sein. Viele Ökonomen sehen die positive Funktion des Privateigentums gegenüber dem Gemeineigentum vor allem in dem Anreiz des Einzelnen, sorgfältig und sparsam mit seinem Eigentum umzugehen und für dessen Erhalt zu sorgen. Prof. Dr. Jörg Rocholl: „Die Grundzüge des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft liegen letztlich darin, die Eigeninteressen der Handelnden zu nutzen, um das Gemeinwohl im Interesse aller zu steigern.“ 1.2 Der Markt In der Wirtschaft sind Rohstoffe, Produkte und Dienstleistungen die Waren, welche von den Verbrauchern konsumiert und bezahlt werden. Man spricht von einem „Markt“. Hier treffen Menschen zusammen, um Güter auszutauschen und damit Geld zu verdienen. Die Unternehmer entscheiden auf dem Markt – der von Angebot und Nachfrage geregelt wird –, was sie produzieren, wo und an wen sie verkaufen. Die Güter, die auf dem Markt gehandelt werden, können landwirtschaftliche oder industriell erzeugte Produkte sein, aber auch Dienstleistungen oder Kapital in Form von Geld, Aktien oder Ähnlichem. Es gibt keinen homogenen Markt, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Märkte. Diese Märkte haben eine Koordinationsfunktion und definieren über Angebot und Nachfrage den Preis. Das Ziel der Unternehmen ist es dabei, den größtmöglichen Gewinn zu realisieren. Prof. Dr. Hans-Werner Sinn: „Die Marktwirtschaft überwindet Knappheit. Das ist vielleicht noch der am meisten ins Auge stechende Vorteil. Wenn irgendwo Lieferengpässe sind, dann kommt es nicht zu Versorgungs-schwierigkeiten, sondern gerade in diesen Bereichen sind dann die Preise hoch. Es lohnt sich für die Unternehmen, dort einzuspringen und die Engpässe zu beseitigen. Das ist also eine gewisse Selbstkorrektur, die hier durch das Profitinteresse der Unternehmer vorhanden ist.“ 1.3 Der Wettbewerb In der Wirtschaft bedeutet Wettbewerb, dass Unternehmen miteinander konkurrieren. Hans-Christian Ströbele: „Ja, der Kapitalismus hat den Vorteil, dass durch dieses Konkurrenzdenken … der eine sticht den anderen aus, das knüpft ja anscheinend an eine menschliche Eigenschaft an. Das kennt ja jeder schon aus der Krippe oder auch aus der Schule. Man ist zu viel mehr fähig, als wenn man sagt: Ihr seid alle gleich und ihr sollt auch gleich bleiben und ihr sollt euch nicht unterschiedlich entwickeln.“ Dirk Müller: „Das führt dazu, dass jemand überhaupt bereit dazu ist, noch etwas zu tun, noch mal extra zu arbeiten, um morgen etwas vorangebracht zu haben. Für sich selbst, für die eigene Familie, für die Gesellschaft. Aber es muss eingebremst werden, da wo es überbordet. Das heißt, der reine Kapitalismus ist schädlich. Der Kapitalismus im Zusammenhang mit dem Sozialen ist das einzig sinnvolle Konstrukt, aus meiner Einschätzung heraus.“ Die Firmen wollen möglichst viele Kunden gewinnen, von deren Geld sie schließlich leben. Deshalb müssen sie gute Produkte anbieten, die möglichst besser und günstiger sind als die Produkte der Konkurrenten. Der Wettbewerb ist der Motor für den Fortschritt und das gute Funktionieren der Wirtschaft. Der Wettbewerb ist das wichtigste Gestaltungselement der Marktwirtschaft. Nicht umsonst sagt der Volksmund: „Konkurrenz belebt das Geschäft“. Doch Wettbewerb erzeugt auch Ungleichheit. Der Erfolg des einen ist der Misserfolg des anderen. 1.5 Soziale Marktwirtschaft Dr. Wolfgang Thierse: „Der europäische Kapitalismus ist anders als der US-amerikanische, der chinesische Kapitalismus und der russische Kapitalismus sind noch mal anders als der in den Entwicklungsländern Afrikas zum Beispiel oder in Südamerika. Und ich bin ein entschiedener Anhänger des europäischen Kapitalismus, der insofern eher soziale Marktwirtschaft ist. Der also versucht, die Vorzüge der Marktwirtschaft, eines lebendigen, leistungsstarken, Fortschritt organisierenden Wettbewerbssystems zu verbinden mit sozialem Ausgleich, mit sozialer Sicherheit, mit Fairness gegenüber den unterschiedlichen Menschen, die in einem solchen Land, einem solchen System leben.“ Die soziale Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Eines der wichtigsten Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft ist der freie Wettbewerb, den es durch staatliche Regelungen und Wettbewerbspolitik zu schützen gilt. Der Staat muss die Wirtschaft fördern, um sich und die sozialen Leistungen finanzieren zu können. Dr. Wolfgang Thierse: „Einen solchen Sozialstaat, wie wir ihn in Deutschland haben und auch in den meisten europäischen Ländern, kennen die USA nicht, haben die südamerikanischen, südafrikanischen Länder nicht und von China und Russland erst gar nicht zu reden. Und die soziale Marktwirtschaft ist, glaube ich, die fortschrittlichste, leistungsstärkste Variante dieses Kapitalismus. Und sie ist gefährdet durch die ganze Welt. Wir leben in einer globalisierten Welt und die Konkurrenz ist größer geworden. Brutalerer Kapitalismus erscheint manchmal leistungsstärker als unser sozialstaatlich gebändigter Kapitalismus. Wir müssen unseren Sozialstaat und unsere soziale Marktwirtschaft verteidigen, gegen die Härte der Konkurrenz in der globalen Welt.“ Dr. Gregor Gysi: „Die soziale Marktwirtschaft, das war keine schlechte Idee. Das heißt, man lässt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer doch … man beteiligt sie an der Entwicklung der Wirtschaft. Und das ist zu einem großen Teil aufgekündigt worden, deshalb würde ich sie heute nicht mehr so nennen.“ Prof. Dr. Hans-Werner Sinn: „Wir haben einen sehr weit, extrem weit entwickelten Sozialstaat. Und dieser Sozialstaat hat es eben bislang auch geschafft, Armut in Deutschland tatsächlich zu verhindern. Wir haben niemanden in Deutschland, der sich hier legal aufhält und arm ist. Denn er hat das Recht, Sozialhilfe zu bekommen. Die Sozialhilfe liegt weit über der Armutsgrenze, wie die OECD sie definiert.“ Hans-Christian Ströbele: „Es gibt viele Menschen in Deutschland, Millionen, nicht nur ein paar Tausend … Millionen von Menschen, die sich Existenzsorgen machen müssen. Und das müsste nicht sein, in einem Land wie Deutschland.“ Wie viel Staat muss sein oder sollte sich der Staat komplett aus der Wirtschaft heraushalten? Dirk Müller: „Ja, der Staat muss zwingend in die Wirtschaft eingreifen. Auf der einen Seite ist unsere Volkswirtschaft so komplex, alles spielt da rein. Das kann man nicht zentral organisieren, das geht nicht, das ist zu komplex, das kann niemand durchdringen. Das ist das freie Spiel der Marktkräfte, der, wenn man so will, Naturgesetze des Marktes/Wirtschaftens, die in der Lage sind, so ein System stabil zu halten. Aber dem Markt dieses ganze Feld alleine zu überlassen, das würde zu einem ganz großen Hauen und Stechen führen. Dann würden sich die Reichsten, die Schwersten, die Mächtigsten, die Aggressivsten durchsetzen und die, die eben nicht so stark sind, die Schwächeren der Gesellschaft, die würden hinten runterfallen. Deswegen ist dieses Zusammenspiel zwischen dem freien Markt einerseits, aber auch den Eingriffen des Staates, um soziale Ungerechtigkeiten rauszunehmen, eine Balance herzustellen – das ist ganz, ganz wichtig. Das nennen wir heute soziale Marktwirtschaft.“ 1.6 Die Staatsquote In der sozialen Marktwirtschaft soll der Staat übermäßige Ungleichheiten im Kapitalismus ausgleichen und sozialpolitische Korrekturen vornehmen. Den Anteil der öffentlichen Ausgaben an der jährlichen Wirtschaftsleistung nennt man Staatsquote. Wie hoch liegt die Staatsquote derzeit in Deutschland und ist damit zu rechnen, dass sie noch weiter wachsen wird? Prof. Dr. Jörg Rocholl: „Diese Staatsquote liegt in Deutschland bei etwa 44 %. Sie ist auch schon mal höher gewesen und sie ist ein ständiger Diskussionspunkt, denn zum einen beklagen viele, dass bei einer zu hohen Staatsquote das freie wirtschaftliche Geschehen zu sehr gestört wird, dass also auch die Anreize verloren gehen, sich wirtschaftlich zu betätigen. Andererseits sagen andere, wenn sie zu niedrig ist, dass dann der Staat einfach seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen kann. Viele Aufgaben, die wir für ganz selbstverständlich nehmen: der Bau von Schulen, von Infrastruktur, von Straßen. Auch die gesamte Frage der Sozialfürsorge, das sind ja wichtige Elemente, die der Staat leisten muss. Wir haben in Deutschland bezüglich der Staatsquote über die letzten zehn Jahre eine gute Entwicklung gesehen. Die Wirtschaft ist auch deshalb so erfolgreich, der Arbeitsmarkt läuft auch deshalb so gut, weil man wieder mehr in den Markt vertraut hat, den Markt weiter gestärkt hat. Man sollte jetzt gerade vorsichtig sein, in dieser guten wirtschaftlichen Lage, dass man nicht Geschenke verteilt, die man dann bedauert, wenn es wirtschaftlich nicht mehr so gut laufen sollte.“ 2. Kapitalismus und Staat 2.1 Geschichte Entstanden ist der moderne Kapitalismus in Europa während des Mittelalters, als sich aus Kaufleuten eine neue Gesellschaftsschicht herausbildete. Im 14. Jahrhundert und während der Renaissance florierten der Handel und das Bankgewerbe in Italien. Die Niederlande war nach Ansicht vieler Historiker die weltweit erste kapitalistisch organisierte Nation. Im 17. Jahrhundert hatten sich die Niederländer ein Handelsimperium aufgebaut. Amsterdam war eine der wohlhabendsten Städte Europas und hier entstand eine der ersten Börsen weltweit. Wo immer es Frühformen des Kapitalismus gab, da hatten diese frühen Kapitalisten auch politisch das Sagen. Natürlich wurden die großen Kaufleute, Patrizier und Geldaristokraten nicht vom Volk gewählt, doch politische Macht und wirtschaftliche Interessen waren nicht zu trennen. Monarchen waren bemüht, das Funktionieren des Handelslebens zu begreifen, um die Wirtschaft zu fördern und wiederum finanzielle Mittel zu haben, um die Kriege in Europa zu überstehen. Legendär wurde der russische Zar Peter der Große, der unter falschem Namen nach Holland reiste, um die Wirtschaft dieser reichen Handelsnation zu studieren. Der Kapitalismus hat immer Staatshilfe genossen. Mit der Industrialisierung und Entwicklung des Kapitalismus veränderten sich die Aufgaben des Staates. Dirk Müller: „Damals in Manchester, England, als die Industrialisierung aufkam, da hat man dem Markt freie Hand gelassen und da hatten die Industriellen alle Macht und haben die Arbeiter ausgebeutet bis zum Umfallen. Die mussten 10, 12, 15 Stunden arbeiten. Sie hatten kaum Rechte und wurden drangsaliert. Das war damals der Kapitalismus pur, wo nur der Starke und Mächtige gewonnen hat. Und das ist dann natürlich schlecht für die Gesellschaft. Für die reinen Unternehmer eine gute Sache, aber nicht für unsere Gesellschaft.“ 2.3 Kapitalismus und Demokratie Der Begriff Demokratie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Herrschaft des Volkes. Über diese Herrschaft und Machtausübung verfügt in der Bundesrepublik jeder Berechtigte durch Wahlen. Der Wahlrechtsgrundsatz, dass Wahlen frei ablaufen müssen, bedeutet, dass jeder seine Stimme ohne Zwang und äußeren Druck abgeben können muss. Außer der Teilnahme an Wahlen kann man sich durch eine Petition, durch Mitarbeit in einer politischen Partei, einem Interessenverband oder durch die Unterstützung einer Bürgerinitiative politisch einbringen. Doch ist Demokratie weltweit immer die beste Regierungsform? Dirk Müller: „Ob Demokratie immer die beste Regierungsform ist? In unseren Breiten ja! Warum? Bei uns hat im 18. Jahrhundert eine Aufklärung stattgefunden, eine Trennung von Staat und Kirche. Es ist eine Gesellschaft entstanden durch die Aufklärung und allem, was danach kam. Eine Gesellschaft, die nicht mehr nur egoistisch gedacht hat, wo der Einzelne nur für seine Klientel gedacht hat, sondern wo der Einzelne auch dazu bereit war, in gesellschaftlichen Normen zu denken, für die Gesellschaft zu denken. Das hat in vielen Ländern der Welt noch nicht stattgefunden. Die sind Jahrhunderte zurück, eine Aufklärung hat nie stattgefunden. Eine absolute Verschmelzung von Religion und Staatswesen. Eine Gesellschaft muss auch reif sein für ein demokratisches System und das ist nicht überall auf der Welt der Fall. Das Problem haben wir oft erkannt, wenn wir mit Gewalt Demokratie erzwingen wollten. Genau das ist wirklich schiefgegangen, weil die Gesellschaft, die Bevölkerung längst noch nicht bereit war für eine Demokratie. Und das heißt, dass das ein Entwicklungsprozess ist, der oftmals über Generationen vonstattengeht.“ Hans-Christian Ströbele: „Ich bin ein großer Verfechter, nicht so sehr der parlamentarischen Demokratie, weil ich seine großen Mängel miterlebe, jetzt als Abgeordneter. Aber gerade auch der Basisdemokratie. Ich glaube – und da bin ich mit dem Bundesverfassungsgesetz einig –, die wirklich demokratischen Entwicklungen, die immer neue Ideen wachsen lassen, die beginnen auf der Straße. Die beginnen da, wo sich jeder von uns immer engagieren kann. Das ist nicht immer das, was ich will, aber durch Demonstratio-nen, durch Kundgebungen, durch Reden, heute natürlich auch im Internet, nicht nur auf der Straße. Aber durch Engagement von Leuten, die sagen, mit dem und dem sind wir nicht einverstanden, das ist eine Fehlentwicklung – und diesen Prozess auf die Straße tragen. Da wird vieles nicht klappen und nicht gleich Erfolg haben, aber wenn man das lange genug macht und der Missstand immer offensichtlicher wird, kann man auch Erfolge haben.“ 2.5 Aufgaben des Staates Das Besondere am kapitalistischen System ist seine Triebfeder: die individuelle Gewinnmaximierung seitens der Unternehmen. Aufgabe des Staates ist es, dem Kapitalismus soziale Schranken zu setzen und eine funktionierende Marktwirtschaft zu sichern. Hans-Werner Sinn: „Innerhalb dieser Regeln dürfen sich die privaten Akteure frei verhalten, aber die Regeln muss der Staat setzen und auch überwachen. Und darüber hinaus greift der Staat natürlich in die Prozesse ein, nicht nur durch die Spielregeln, indem er eben lenkende Steuern einführt, indem er Gebote und Verbote erlässt. Und das ist auch richtig, weil eben Märkte auch Fehler haben.“ Gesetze sind notwendig, um den Drang des Kapitals nach marktbeherrschender Stellung, nach Lohndumping, nach Verbrauchertäuschung, Steuerhinterziehung und hemmungsloser Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in Grenzen zu halten. 3. Vor- und Nachteile des Kapitalismus 3.1 Wohlstand und soziale Ungleichheit Der Kapitalismus erwirtschaftet Wohlstand. Nie zuvor war die Menschheit materiell so reich. Allein in den vergangenen 50 Jahren ist das globale Bruttosozialprodukt nominell um rund 2.000 Prozent auf 13.800 Dollar pro Kopf angestiegen. Doch ist der Wohlstand extrem ungleich verteilt. Dr. Gregor Gysi: „Weltweit war es so, dass vor fünf Jahren die reichsten 388 Personen genauso viel Vermögen hatten wie die finanziell untere Hälfte der Menschheit. Das heißt, wie 3,6 Milliarden Menschen. Heute haben die 62 reichsten so viel wie die 3,6 Milliarden und in fünf Jahren sind es 31 und irgendwann ist es einer.“ Dirk Müller: „Oh, diese Kritik am System ist sehr, sehr berechtigt, denn natürlich sind wir wahrscheinlich Jahrhunderte von einem wirklich fairen System entfernt. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft dramatisch auseinander. Warum? Weil wir diese Systeme der sozialen Marktwirtschaft nicht mehr im Gleichgewicht haben. Es gibt immer Unterschiede, die wird es auch immer geben, aber das muss in einer bestimmten Balance zueinander stehen. Es war schon immer so, dass der Chef eines Unternehmens, der Besitzer einer Firma mehr verdient hat als der einfache Arbeiter, der unten die kleinste Arbeit macht. Das wird auch immer so sein, aber das Verhältnis muss stimmen.“ Hans-Christian Ströbele: „Indem man durch gesetzliche Vorschriften etwa regelt, dass die Superreichen, … die ja über so hohe Vermögen verfügen, das sie niemals ausgeben können, sodass sie das Geld dann nur noch für Machtgewinne ausgeben, weil sie selber das gar nicht verbrauchen können – dass die von ihrem Reichtum etwas abgeben. Das haben sie ja in der Regel auch nicht selber erwirtschaftet, weil sie besonders viel Tag und Nach gearbeitet haben. Sondern, dass das so verteilt wird, dass die Menschen wirklich gleich sind.“ Prof. Dr. Hans-Werner Sinn: „Wenn ich jetzt eine wie auch immer definierte Gerechtigkeitsvorstellung als einziges Ziel ansehe und will die Wirtschaft so gestalten, damit das realisiert wird, dann muss ich sehr stark umverteilen. Ich muss von denen, die Erfolg gehabt haben, viel Geld wegnehmen und sehr viel den anderen geben. Dann sind aber die Leistungsanreize nicht mehr da und dann funktioniert die Marktwirtschaft nicht mehr. Das heißt, ein Maximum an Gerechtigkeit kriegt man nur in einer in Armut erstarrenden Gesellschaft.“ Prof. Dr. Jörg Rocholl: „Der entscheidende Punkt, gerade auch in der Frage, wie man die Unterschiede zwischen Arm und Reich geringer gestalten kann, ist Investition in Bildung. Denn das hat sich in allen Studien erwiesen als die beste Basis dafür, dass sich Kinder, Jugendliche entwickeln können, dass sie Chancen haben, die weit über die wirtschaftlichen Möglichkeiten hinausgehen. Und deshalb halte ich es für eine ganz zentrale Aufgabe des Staates, die Bildungsinvestitionen hoch zu halten, sogar noch weiter zu erhöhen und insbesondere so früh wie möglich damit zu beginnen.“ 3.3 Kapitalismuskritik Prof. Dr. Jörg Rocholl: „Der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft hat sicherlich nicht ausgedient, aber er sieht sich großer Kritik gegenüber, auch zu Recht Kritik gegenüber, weil es ja verschiedene Dinge gibt, die in den letzten Jahren nicht so funktioniert haben, wie man das möchte. Insbesondere halte ich für den Hauptkritikpunkt, dass viele, die sich zum Beispiel an Banken beteiligt haben, die also Gläubiger von Anteilen an Banken waren, am Ende, als diese Banken in Probleme geraten sind, keine eigenen Verluste zu erleiden hatten. Dass man also dieses geflügelte Sprichwort gesehen hat, dass Gewinne privatisiert, aber Verluste sozialisiert werden. Und letztlich gehört es zu den Prinzipien der Marktwirtschaft, dass es immer eine Einheit von Eigentum und Haftung geben muss. Das heißt, dass derjenige, der ein Eigentum besitzt und auch zu Recht besitzt, damit rechnen muss und auch damit rechnen sollte, dass es auch eine Verlustchance gibt. Denn die ganzen Gewinnchancen sind nur dann gerechtfertigt, wenn er auch tatsächlich in die Gefahr geraten kann, Verluste zu erleiden. Und das ist etwas, was gerade im Zuge der Finanzkrise nicht gut funktioniert hat. Und deswegen ist es wichtig, dass der Staat hier eingreift, dass reguliert wird, um sicherzustellen, dass diese Identität von Eigentum und Haftung wieder hergestellt wird.“ Dr. Wolfgang Thierse: „Dass wir in einem Land leben, das voller Ungerechtigkeiten steckt, wo die Reichen immer reicher geworden sind und viele Arme große Schwierigkeiten haben, das ist eine große Herausforderung für eine demokratische Politik.“ Bodo Ramelow: „Ich habe kein Verständnis, wenn die Zocker dieser Welt mit Milliarden spekulieren und dann in Afrika zum Beispiel Tausende Familien ihr Land verlieren, ihre Ernährungsgrundlage verlieren. Wenn mit Nahrungsmitteln spekuliert wird, das halte ich für ethisch unerträglich. Ich finde, Nahrungsmittel haben an Spekulationsmärkten nichts zu suchen.“ Dirk Müller: „Dass Sie und ich einfach mal, weil wir heute Lust dazu haben, Millionen Tonnen Reis einfach so virtuell in den Keller legen können, damit den Preis mit nach oben treiben, ohne dass wir mit dem Reis irgendwas zu tun haben, ohne dass wir Reis anbauen oder Reis verarbeiten, sondern einfach nur, weil uns danach ist und wir Geld verdienen wollen. Das ist eine Sache … das ist eine Sauerei, weil es hier um das Leben und die Gesundheit von Menschen rund um den Globus geht. Für den Profit von wenigen, was volkswirtschaftlich nur Schaden anrichtet und keinen Vorteil hat – das gehört schlichtweg verboten.“ Dr. Gregor Gysi: „Ich sage Ihnen nur: Jedes Jahr sterben 70 Millionen Menschen. Davon 18 Millionen an Hunger, das ist die häufigste Todesursache. Und das, obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? Das hat etwas mit dem Kapitalismus zu tun, das hat etwas damit zu tun, dass man auf andere Art und Weise verdient. Und das ist keine wirkliche Entwicklungspolitik für Afrika und für andere Regionen. Das sind alles Katastrophen. Das Interessante ist: Erst jetzt kommen die Weltprobleme zu uns. Viele Menschen in Afrika wussten ja früher nicht, wie wir in Europa leben. Durch die Digitalisierung wissen sie es. Und nun stellen sie Fragen an uns, auf die wir keine Antworten haben. So einfach ist das und deswegen erleben wir jetzt auch – nicht nur deshalb, auch wegen der Kriege – diese riesigen Zahlen an Flüchtlingen. Und nun steht auch meine Regierung, unsere Regierung vor einer Frage: Entweder wir probieren ernsthaft, die Weltprobleme zu lösen oder die Situation bei uns kann unbeherrschbar werden.“ Die Umwelt wird durch das stetige Wirtschaftswachstum immer mehr belastet, weil mit dem Wachstum in der uns bekannten Art und Weise auch ein höherer Bedarf an Energie verbunden ist. Der ökologische Schaden, der mit dem Wachstumswahn angerichtet wird, ist so hoch, dass nachfolgende Generationen vor großen Problemen stehen werden. 3.5 Gibt es Alternativen? Prof. Dr. Hans-Werner Sinn: „Naja, natürlich gibt es auch andere Wirtschaftssysteme. Der Sozialismus ist ja nun lange genug probiert worden, in Russland und auch der ganzen Sowjetunion. Da gibt es dann eben keine privatwirtschaftlichen Anreize. Man wird nicht reich, wenn man die Marktlücken entdeckt, sondern man muss einfach dieses oder jenes tun. Und was man tun soll, wird von oben gesagt.“ Hans-Christian Ströbele: „Ja, ich bin der Meinung, dass alle Menschen nicht nur die gleichen Chancen haben müssen, sondern, dass alle Menschen auch ein Recht auf Grundversorgung haben. Und zwar sowohl auf Bildung – also Schule, wenn sie wollen Universität – als auch natürlich Essen, Trinken, Wohnen usw. Und dass der Staat sowas garantieren muss. Das heißt, er muss verhindern, dass die einen zu reich werden und die anderen zurückbleiben und so arm werden, dass sie Existenzsorgen haben.“ Prof. Dr. Hans-Werner Sinn: „Die Marktwirtschaft wird so lange überleben, wie eben die Massen einen vernünftigen Lebensstandard dabei haben. Wenn sie es nicht mehr haben und dabei eine Alternative sichtbar ist, dann machen sie eine Revolution. Das hat immer als Aspekt mitgewirkt bei der Entwicklung des Sozialstaates und wird es auch in Zukunft tun. Das ist ja auch richtig so, nur sollte man sich nicht vorstellen, es gäbe die Alternative. Die Historie hat gezeigt, dass die Marktwirtschaft die Masseneinkommen in einer dramatischen Art und Weise entwickelt und einen Lebensstandard schafft, von dem die kommunistischen Systeme nicht mal träumen konnten.“ Extro Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das von individuellem Gewinnstreben ausgeht und dieses in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen versucht. Bisher gibt es keine Alternative zum kapitalistischen System, doch sollten in Zukunft die unterschiedlichen Ansprüche der Menschen in den verschiedenen Regionen einer globalisierten und wirtschaftlich eng vernetzten Welt fairer verteilt werden.